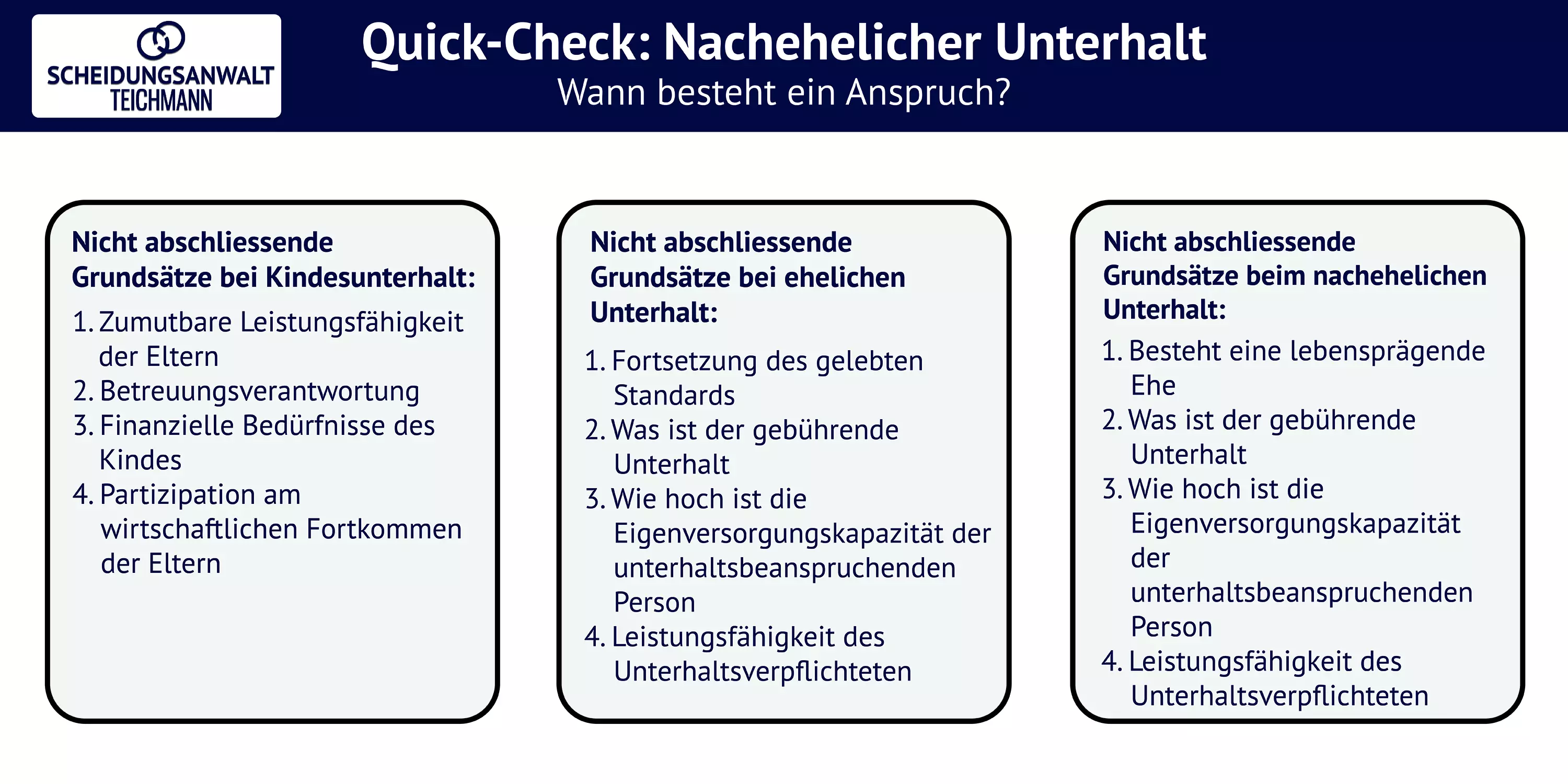Der nacheheliche Unterhalt basiert auf verschiedenen rechtlichen Grundlagen. Die zentralen Bestimmungen gehen aus dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) hervor. Insbesondere sind die Artikel 125 bis 132 des ZGB für den nachehelichen Unterhalt von Bedeutung. Die genannten Artikel behandeln den Unterhaltsanspruch nach der Scheidung und legen die Voraussetzungen fest, unter denen ein geschiedener Ehepartner Anspruch auf Unterhalt hat.
1. Art. 125 ZGB besagt, dass nach der Scheidung jeder Ehepartner Anspruch auf Unterhalt hat, soweit dies erforderlich ist, um seinen angemessenen Lebensbedarf zu decken. Des Weiteren listet der Artikel Faktoren auf, welche in Hinblick auf die Höhe und Dauer der Unterhaltsbeiträge zu berücksichtigen sind.
2. Art. 129 ZGB nennt die Voraussetzungen für eine Abänderung der Unterhaltsbeiträge aufgrund erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse.
Diese Bestimmungen stellen lediglich allgemeine Richtlinien dar. Die konkrete Ausgestaltung des nachehelichen Unterhalts ist fallabhängig, weswegen die bundesgerichtliche Rechtsprechung ebenfalls berücksichtigt werden muss.